Samstag, 5. März 2016
Generation Smartphone – die geistige Diaspora
Manchmal stelle ich mir vor, wie wohl mein Großvater auf die jetzige Zeit reagieren würde, wenn er heute im Jahr 2016 plötzlich wieder zum Leben erwachte. Wenn er beispielsweise in einem Bus sitzen würde, in dem neunzig Prozent der Fahrgäste hochkonzentriert in ihr Handinneres blicken. Oder wenn ihm jemand gegenüber säße, der plötzlich aus heiterem Himmel anfängt zu reden und zwar ohne jeglichen Gesprächspartner. Und was würde mein Großvater empfinden, wenn auf einem Familienfest immer wieder eines der Familienmitglieder plötzlich mitten im Gespräch für eine kurze Zeit verschwindet, weil sich irgendetwas in der Hosentasche befindet, das anscheinend irgendein Signal sendet auf das umgehend reagiert werden muss?
Was wäre die Reaktion meines Großvaters, wenn man abends nicht mehr wie üblich gemeinsam eine Fernsehsendung ansehen oder ein Brettspiel spielen würde, sondern stattdessen jeder gebannt in ein kleines Gerät schaute, auf das er gleichzeitig hochkonzentriert in Windeseile mit den Fingerspitzen tippen würde? Was würde mein Opa davon halten, wenn jemand mit Stöpseln im Ohr auf das kleine geheimnisvolle Gerät schaut und sich dabei angeregt unterhält?
Ich glaube, mein Großvater verstände die Welt nicht mehr. Wodurch er sich von mir als seiner Enkelin gar nicht wesentlich unterscheiden würde. Menschliche Kommunikation ist inzwischen zur Karikatur geworden.
Die Generation Smartphone befindet sich überall – nur nicht in der konkreten Situation mit ihren real vorhandenen Menschen. Diese sind zur verzichtbaren Nebensache degradiert und der menschliche Geist hat sich klammheimlich aus der analogen Realität verabschiedet, irgendwo in der digitalen Diaspora, wo er mit anderen ebenfalls nur digital vorhandenen Geschöpfen kommuniziert. Wobei der Ausdruck menschlicher Geist im Grunde gar nicht mehr gerechtfertigt ist. Denn Geist kann nicht getrennt werden vom Denken und von sinnhafter menschlicher Sprache. Und von Denken und Sinnhaftigkeit kann man mit Sicherheit nicht mehr sprechen angesichts der unzähligen *lol*, *grins*, *omg*, ;-), :-( etc.
Um auf meinen Großvater zurückzukommen – er würde wahrscheinlich nur verständnislos den Kopf schütteln und es nicht bedauern, diese Zeit nicht mehr miterlebt zu haben.
Übrigens: Als mein Opa in den Sechzigern das erste Mal einen Anruf erhielt, hörte er nichts, da er den Hörer verkehrt herum – also die Sprechmuschel anstatt die Hörmuschel – ans Ohr hielt. Ein eigenes Telefon hat er auch zeitlebens nie für notwendig gehalten, das Telefon seines im Untergeschoss wohnenden Sohnes reichte völlig aus für die ein- bis zwei Telefonate, die er im Jahr führte und die nie mehr als ein paar Minuten Minuten dauerten.
Telefon hat er auch zeitlebens nie für notwendig gehalten, das Telefon seines im Untergeschoss wohnenden Sohnes reichte völlig aus für die ein- bis zwei Telefonate, die er im Jahr führte und die nie mehr als ein paar Minuten Minuten dauerten.
Was wäre die Reaktion meines Großvaters, wenn man abends nicht mehr wie üblich gemeinsam eine Fernsehsendung ansehen oder ein Brettspiel spielen würde, sondern stattdessen jeder gebannt in ein kleines Gerät schaute, auf das er gleichzeitig hochkonzentriert in Windeseile mit den Fingerspitzen tippen würde? Was würde mein Opa davon halten, wenn jemand mit Stöpseln im Ohr auf das kleine geheimnisvolle Gerät schaut und sich dabei angeregt unterhält?
Ich glaube, mein Großvater verstände die Welt nicht mehr. Wodurch er sich von mir als seiner Enkelin gar nicht wesentlich unterscheiden würde. Menschliche Kommunikation ist inzwischen zur Karikatur geworden.
Die Generation Smartphone befindet sich überall – nur nicht in der konkreten Situation mit ihren real vorhandenen Menschen. Diese sind zur verzichtbaren Nebensache degradiert und der menschliche Geist hat sich klammheimlich aus der analogen Realität verabschiedet, irgendwo in der digitalen Diaspora, wo er mit anderen ebenfalls nur digital vorhandenen Geschöpfen kommuniziert. Wobei der Ausdruck menschlicher Geist im Grunde gar nicht mehr gerechtfertigt ist. Denn Geist kann nicht getrennt werden vom Denken und von sinnhafter menschlicher Sprache. Und von Denken und Sinnhaftigkeit kann man mit Sicherheit nicht mehr sprechen angesichts der unzähligen *lol*, *grins*, *omg*, ;-), :-( etc.
Um auf meinen Großvater zurückzukommen – er würde wahrscheinlich nur verständnislos den Kopf schütteln und es nicht bedauern, diese Zeit nicht mehr miterlebt zu haben.
Übrigens: Als mein Opa in den Sechzigern das erste Mal einen Anruf erhielt, hörte er nichts, da er den Hörer verkehrt herum – also die Sprechmuschel anstatt die Hörmuschel – ans Ohr hielt. Ein eigenes
 Telefon hat er auch zeitlebens nie für notwendig gehalten, das Telefon seines im Untergeschoss wohnenden Sohnes reichte völlig aus für die ein- bis zwei Telefonate, die er im Jahr führte und die nie mehr als ein paar Minuten Minuten dauerten.
Telefon hat er auch zeitlebens nie für notwendig gehalten, das Telefon seines im Untergeschoss wohnenden Sohnes reichte völlig aus für die ein- bis zwei Telefonate, die er im Jahr führte und die nie mehr als ein paar Minuten Minuten dauerten.Dienstag, 25. Februar 2014
Worpswede – Künstler, Künstlerinnen, Utopie und Alltag
Das vergangene Wochenende verbrachte ich in dem Künstlerdorf Worpswede. Vor ein paar Monaten habe ich dieses Dorf das erste Mal besucht und es hat mich in seinen Bann gezogen. Ich liebe die Bilder der Moorlandschaften, die eine merkwürdige Mischung aus dunklen Grundtönen und leuchtenden Farben darstellen.  Eigentlich hatte ich die Übernachtung im „Haus im Schluh“ geplant, in welchem die frühere Ehefrau Heinrich Vogelers gewohnt hatte, aber zur Zeit sind dort keine Übernachtungen möglich. Eine Übernachtung in dem ehemaligen Atelier Paula Modersohn-Beckers war ebenfalls nicht möglich, so dass wir uns schließlich ein ganz normales Hotel nahmen, was dem Wochenende jedoch keinen Abbruch tat.
Eigentlich hatte ich die Übernachtung im „Haus im Schluh“ geplant, in welchem die frühere Ehefrau Heinrich Vogelers gewohnt hatte, aber zur Zeit sind dort keine Übernachtungen möglich. Eine Übernachtung in dem ehemaligen Atelier Paula Modersohn-Beckers war ebenfalls nicht möglich, so dass wir uns schließlich ein ganz normales Hotel nahmen, was dem Wochenende jedoch keinen Abbruch tat.
Der Barkenhof, das Haus am Schluh, das Otto-Modersohn-Haus – alles Zeugnisse einer Zeit, in der Worpswede eine Ort des Zusammenlebens von Künstlern war. Nicht zu vergessen die „Käseglocke“,ein winziges kugelrundes Museum, das seinem Besitzer zeitlebens als Wohnhaus diente und das so urgemütlich ist, dass man am liebsten sofort dort einziehen möchte. Während ich mich beim ersten Aufenthalt in ein Buch von Paula Modersohn-Becker vertieft hatte, hatte es mir diesmal Heinrich Vogeler angetan,
Nicht zu vergessen die „Käseglocke“,ein winziges kugelrundes Museum, das seinem Besitzer zeitlebens als Wohnhaus diente und das so urgemütlich ist, dass man am liebsten sofort dort einziehen möchte. Während ich mich beim ersten Aufenthalt in ein Buch von Paula Modersohn-Becker vertieft hatte, hatte es mir diesmal Heinrich Vogeler angetan,  dessen Werke in einer beeindruckenden Bandbreite seinen dramatischen Werdegang widerspiegeln. Beginnend mit wunderschönen Jugendstilwerken verändern sich die Motive durch die Erfahrungen des ersten Weltkriegs hin zu expressionistischen Anklagen der Kriegsgräuel und verkörpern gegen Ende seines Lebens die Ideale des Kommunismus. Ein gut betuchter Schöngeist und Idealist beendet sein Leben zwar verarmt und krank, aber immer noch von der Idee einer gerechteren Welt überzeugt. In Kasachstan, wo Heinrich Vogeler 1942 verstarb, gibt es noch nicht einmal ein Grab.
dessen Werke in einer beeindruckenden Bandbreite seinen dramatischen Werdegang widerspiegeln. Beginnend mit wunderschönen Jugendstilwerken verändern sich die Motive durch die Erfahrungen des ersten Weltkriegs hin zu expressionistischen Anklagen der Kriegsgräuel und verkörpern gegen Ende seines Lebens die Ideale des Kommunismus. Ein gut betuchter Schöngeist und Idealist beendet sein Leben zwar verarmt und krank, aber immer noch von der Idee einer gerechteren Welt überzeugt. In Kasachstan, wo Heinrich Vogeler 1942 verstarb, gibt es noch nicht einmal ein Grab.
Ich ließ es mir nicht nehmen, mich im großen Saal des Barkenhof auf den roten Ledersessel zu setzen, auf dem Rainer Maria Rilke sonntags seine Gedichte vorlas. Und auf dem Rückweg von Fischerhude, in dem wir das Otto Modersohn Museum besuchten, kehrten wir auch in das Rilke-Café ein, in dem Rilke mit seiner Frau, der Bildhauerin Clara Westhoff, gewohnt hatte. Allerdings wohnten beide dort nur für kurze Zeit, denn schon bald trennten sie sich und Rilke verließ Worpswede.
Wenn man sich mit den Biographien der Künstler beschäftigt, kommt man zu dem Schluss, dass Künstlerehen zwar hochromantisch beginnen, aber am Alltag scheitern. In dem Moment, wo Kinder vorhanden sind, steht das tägliche Einerlei im krassen Widerspruch zur künstlerischen Selbstverwirklichung. Die Ehe Heinrich und Martha Vogeler und Rainer Maria Rilke und Clara Westhoff scheiterten und auch die Ehe Otto Modersohn und Paula Modersohn-Becker kriselte. Paula Modersohn-Becker verstarb kurz nach der Geburt ihrer Tochter und wenn man ihre Tagebuchaufzeichnungen und Briefe liest, dann ist man sich sicher, dass sie nicht zur Hausfrau und Mutter geschaffen war. Sie ließ sich zwar von der Tochter ihres Mannes aus dessen erster Ehe mit Mutter ansprechen, aber sie entzog sich den Verpflichtungen einer Mutter immer wieder durch ihre Studienreisen nach Paris und überließ anderen die Sorge um die Stieftochter. In diesem Verhalten unterschied sie sich jedoch in keiner Weise von ihren männlichen Kollegen, für die es selbstverständlich war, der beruflichen Selbstverwirklichung den Vorrang vor der Verpflichtung gegenüber den Kindern zu geben.
Die Ehe Heinrich und Martha Vogeler und Rainer Maria Rilke und Clara Westhoff scheiterten und auch die Ehe Otto Modersohn und Paula Modersohn-Becker kriselte. Paula Modersohn-Becker verstarb kurz nach der Geburt ihrer Tochter und wenn man ihre Tagebuchaufzeichnungen und Briefe liest, dann ist man sich sicher, dass sie nicht zur Hausfrau und Mutter geschaffen war. Sie ließ sich zwar von der Tochter ihres Mannes aus dessen erster Ehe mit Mutter ansprechen, aber sie entzog sich den Verpflichtungen einer Mutter immer wieder durch ihre Studienreisen nach Paris und überließ anderen die Sorge um die Stieftochter. In diesem Verhalten unterschied sie sich jedoch in keiner Weise von ihren männlichen Kollegen, für die es selbstverständlich war, der beruflichen Selbstverwirklichung den Vorrang vor der Verpflichtung gegenüber den Kindern zu geben.
In einem kleinen Film über Heinrich Vogeler, der im Barkenhof gezeigt wird, wird ein Brief Rilkes zitiert, in dem er sich auf eine merkwürdige Art über die Geburt der dritten Tochter Vogelers äußert. Ich bin ausgesprochener Rilke-Fan, aber die Aussagen empfand ich als befremdlich. Ich habe nicht alles wortgetreu behalten, aber sinngemäß schrieb er von bedrückender Enge und einem nichtssagenden Namen, auf den die Tochter getauft wurde, der symbolisch wäre für das seiner Ansicht nach inzwischen nichtssagende und ereignislose Leben auf dem Barkenhof. Anscheinend gab es in seinen Augen nicht mehr genug Platz für Philosophie und Poesie auf einem Hof mit Kindergeschrei. Das Leben dort deswegen als ereignislos zu bezeichnen, heißt jedoch, das Leben an sich als ereignislos anzusehen – eine merkwürdige Sichtweise, denn Leben spielt sich nicht in Reflexionen über das Leben ab, sondern im Leben selbst mit seinen unterschiedlichen Lebensstufen und deren Herausforderungen.
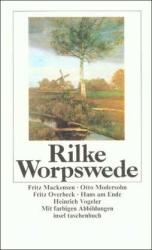 Künstler sind eine Bereicherung für die Gesellschaft, die ohne deren Kunst um vieles ärmer wäre. Für die nahen Angehörigen ist das Zusammenleben mit einem Künstler oder einer Künstlerin allerdings meist nur dann verwirklichbar, wenn die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt werden oder in der Arbeit des Ehepartners aufgehen. Letzteres wird oft erkennbar in Ehefrauen, die ihrem Mann den Rücken freihalten und sich voll und ganz mit dessen Schaffen identifizieren. Ohne dies hier bewerten zu wollen, ist es eine unumgängliche Tatsache, dass künstlerische Selbstverwirklichung nur unter ganz bestimmten Bedingungen alltagstauglich ist.
Künstler sind eine Bereicherung für die Gesellschaft, die ohne deren Kunst um vieles ärmer wäre. Für die nahen Angehörigen ist das Zusammenleben mit einem Künstler oder einer Künstlerin allerdings meist nur dann verwirklichbar, wenn die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt werden oder in der Arbeit des Ehepartners aufgehen. Letzteres wird oft erkennbar in Ehefrauen, die ihrem Mann den Rücken freihalten und sich voll und ganz mit dessen Schaffen identifizieren. Ohne dies hier bewerten zu wollen, ist es eine unumgängliche Tatsache, dass künstlerische Selbstverwirklichung nur unter ganz bestimmten Bedingungen alltagstauglich ist.
Gerade weil die Lebensgeschichten der einzelnen Künstler aus Worpswede von vielen Widersprüchen und Turbolenzen gekennzeichnet ist, ist es so ungemein interessant, sich darin zu vertiefen. Die Worpsweder Künstlergemeinschaft bestand nur relativ kurze Zeit, aber vielleicht ist es genau das, was ihr eine gewisse Unsterblichkeit verleiht, denn sie wurde beendet, bevor sie sich an den Widrigkeiten des Alltags und der unterschiedlichen Lebensentwürfe zerrieb.
 Ich werde auf jeden Fall wieder nach Worpswede fahren und mich vorher mit Lektüre über die beeindruckenden Menschen der Künstlerkolonie einstimmen. Zur Zeit lese ich mein dort erworbenes Buch „Kunst und Glaube in Worpswede“, das mit wunderschönen Bildern illustriert ist. Und beim nächsten Mal werde ich es mir gönnen, in Paula Modersohn-Beckers Künstleratelier zu wohnen.
Ich werde auf jeden Fall wieder nach Worpswede fahren und mich vorher mit Lektüre über die beeindruckenden Menschen der Künstlerkolonie einstimmen. Zur Zeit lese ich mein dort erworbenes Buch „Kunst und Glaube in Worpswede“, das mit wunderschönen Bildern illustriert ist. Und beim nächsten Mal werde ich es mir gönnen, in Paula Modersohn-Beckers Künstleratelier zu wohnen.
 Eigentlich hatte ich die Übernachtung im „Haus im Schluh“ geplant, in welchem die frühere Ehefrau Heinrich Vogelers gewohnt hatte, aber zur Zeit sind dort keine Übernachtungen möglich. Eine Übernachtung in dem ehemaligen Atelier Paula Modersohn-Beckers war ebenfalls nicht möglich, so dass wir uns schließlich ein ganz normales Hotel nahmen, was dem Wochenende jedoch keinen Abbruch tat.
Eigentlich hatte ich die Übernachtung im „Haus im Schluh“ geplant, in welchem die frühere Ehefrau Heinrich Vogelers gewohnt hatte, aber zur Zeit sind dort keine Übernachtungen möglich. Eine Übernachtung in dem ehemaligen Atelier Paula Modersohn-Beckers war ebenfalls nicht möglich, so dass wir uns schließlich ein ganz normales Hotel nahmen, was dem Wochenende jedoch keinen Abbruch tat. Der Barkenhof, das Haus am Schluh, das Otto-Modersohn-Haus – alles Zeugnisse einer Zeit, in der Worpswede eine Ort des Zusammenlebens von Künstlern war.
 Nicht zu vergessen die „Käseglocke“,ein winziges kugelrundes Museum, das seinem Besitzer zeitlebens als Wohnhaus diente und das so urgemütlich ist, dass man am liebsten sofort dort einziehen möchte. Während ich mich beim ersten Aufenthalt in ein Buch von Paula Modersohn-Becker vertieft hatte, hatte es mir diesmal Heinrich Vogeler angetan,
Nicht zu vergessen die „Käseglocke“,ein winziges kugelrundes Museum, das seinem Besitzer zeitlebens als Wohnhaus diente und das so urgemütlich ist, dass man am liebsten sofort dort einziehen möchte. Während ich mich beim ersten Aufenthalt in ein Buch von Paula Modersohn-Becker vertieft hatte, hatte es mir diesmal Heinrich Vogeler angetan,  dessen Werke in einer beeindruckenden Bandbreite seinen dramatischen Werdegang widerspiegeln. Beginnend mit wunderschönen Jugendstilwerken verändern sich die Motive durch die Erfahrungen des ersten Weltkriegs hin zu expressionistischen Anklagen der Kriegsgräuel und verkörpern gegen Ende seines Lebens die Ideale des Kommunismus. Ein gut betuchter Schöngeist und Idealist beendet sein Leben zwar verarmt und krank, aber immer noch von der Idee einer gerechteren Welt überzeugt. In Kasachstan, wo Heinrich Vogeler 1942 verstarb, gibt es noch nicht einmal ein Grab.
dessen Werke in einer beeindruckenden Bandbreite seinen dramatischen Werdegang widerspiegeln. Beginnend mit wunderschönen Jugendstilwerken verändern sich die Motive durch die Erfahrungen des ersten Weltkriegs hin zu expressionistischen Anklagen der Kriegsgräuel und verkörpern gegen Ende seines Lebens die Ideale des Kommunismus. Ein gut betuchter Schöngeist und Idealist beendet sein Leben zwar verarmt und krank, aber immer noch von der Idee einer gerechteren Welt überzeugt. In Kasachstan, wo Heinrich Vogeler 1942 verstarb, gibt es noch nicht einmal ein Grab. Ich ließ es mir nicht nehmen, mich im großen Saal des Barkenhof auf den roten Ledersessel zu setzen, auf dem Rainer Maria Rilke sonntags seine Gedichte vorlas. Und auf dem Rückweg von Fischerhude, in dem wir das Otto Modersohn Museum besuchten, kehrten wir auch in das Rilke-Café ein, in dem Rilke mit seiner Frau, der Bildhauerin Clara Westhoff, gewohnt hatte. Allerdings wohnten beide dort nur für kurze Zeit, denn schon bald trennten sie sich und Rilke verließ Worpswede.
Wenn man sich mit den Biographien der Künstler beschäftigt, kommt man zu dem Schluss, dass Künstlerehen zwar hochromantisch beginnen, aber am Alltag scheitern. In dem Moment, wo Kinder vorhanden sind, steht das tägliche Einerlei im krassen Widerspruch zur künstlerischen Selbstverwirklichung.
 Die Ehe Heinrich und Martha Vogeler und Rainer Maria Rilke und Clara Westhoff scheiterten und auch die Ehe Otto Modersohn und Paula Modersohn-Becker kriselte. Paula Modersohn-Becker verstarb kurz nach der Geburt ihrer Tochter und wenn man ihre Tagebuchaufzeichnungen und Briefe liest, dann ist man sich sicher, dass sie nicht zur Hausfrau und Mutter geschaffen war. Sie ließ sich zwar von der Tochter ihres Mannes aus dessen erster Ehe mit Mutter ansprechen, aber sie entzog sich den Verpflichtungen einer Mutter immer wieder durch ihre Studienreisen nach Paris und überließ anderen die Sorge um die Stieftochter. In diesem Verhalten unterschied sie sich jedoch in keiner Weise von ihren männlichen Kollegen, für die es selbstverständlich war, der beruflichen Selbstverwirklichung den Vorrang vor der Verpflichtung gegenüber den Kindern zu geben.
Die Ehe Heinrich und Martha Vogeler und Rainer Maria Rilke und Clara Westhoff scheiterten und auch die Ehe Otto Modersohn und Paula Modersohn-Becker kriselte. Paula Modersohn-Becker verstarb kurz nach der Geburt ihrer Tochter und wenn man ihre Tagebuchaufzeichnungen und Briefe liest, dann ist man sich sicher, dass sie nicht zur Hausfrau und Mutter geschaffen war. Sie ließ sich zwar von der Tochter ihres Mannes aus dessen erster Ehe mit Mutter ansprechen, aber sie entzog sich den Verpflichtungen einer Mutter immer wieder durch ihre Studienreisen nach Paris und überließ anderen die Sorge um die Stieftochter. In diesem Verhalten unterschied sie sich jedoch in keiner Weise von ihren männlichen Kollegen, für die es selbstverständlich war, der beruflichen Selbstverwirklichung den Vorrang vor der Verpflichtung gegenüber den Kindern zu geben. In einem kleinen Film über Heinrich Vogeler, der im Barkenhof gezeigt wird, wird ein Brief Rilkes zitiert, in dem er sich auf eine merkwürdige Art über die Geburt der dritten Tochter Vogelers äußert. Ich bin ausgesprochener Rilke-Fan, aber die Aussagen empfand ich als befremdlich. Ich habe nicht alles wortgetreu behalten, aber sinngemäß schrieb er von bedrückender Enge und einem nichtssagenden Namen, auf den die Tochter getauft wurde, der symbolisch wäre für das seiner Ansicht nach inzwischen nichtssagende und ereignislose Leben auf dem Barkenhof. Anscheinend gab es in seinen Augen nicht mehr genug Platz für Philosophie und Poesie auf einem Hof mit Kindergeschrei. Das Leben dort deswegen als ereignislos zu bezeichnen, heißt jedoch, das Leben an sich als ereignislos anzusehen – eine merkwürdige Sichtweise, denn Leben spielt sich nicht in Reflexionen über das Leben ab, sondern im Leben selbst mit seinen unterschiedlichen Lebensstufen und deren Herausforderungen.
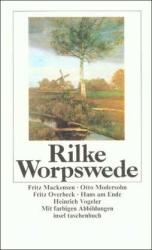 Künstler sind eine Bereicherung für die Gesellschaft, die ohne deren Kunst um vieles ärmer wäre. Für die nahen Angehörigen ist das Zusammenleben mit einem Künstler oder einer Künstlerin allerdings meist nur dann verwirklichbar, wenn die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt werden oder in der Arbeit des Ehepartners aufgehen. Letzteres wird oft erkennbar in Ehefrauen, die ihrem Mann den Rücken freihalten und sich voll und ganz mit dessen Schaffen identifizieren. Ohne dies hier bewerten zu wollen, ist es eine unumgängliche Tatsache, dass künstlerische Selbstverwirklichung nur unter ganz bestimmten Bedingungen alltagstauglich ist.
Künstler sind eine Bereicherung für die Gesellschaft, die ohne deren Kunst um vieles ärmer wäre. Für die nahen Angehörigen ist das Zusammenleben mit einem Künstler oder einer Künstlerin allerdings meist nur dann verwirklichbar, wenn die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt werden oder in der Arbeit des Ehepartners aufgehen. Letzteres wird oft erkennbar in Ehefrauen, die ihrem Mann den Rücken freihalten und sich voll und ganz mit dessen Schaffen identifizieren. Ohne dies hier bewerten zu wollen, ist es eine unumgängliche Tatsache, dass künstlerische Selbstverwirklichung nur unter ganz bestimmten Bedingungen alltagstauglich ist. Gerade weil die Lebensgeschichten der einzelnen Künstler aus Worpswede von vielen Widersprüchen und Turbolenzen gekennzeichnet ist, ist es so ungemein interessant, sich darin zu vertiefen. Die Worpsweder Künstlergemeinschaft bestand nur relativ kurze Zeit, aber vielleicht ist es genau das, was ihr eine gewisse Unsterblichkeit verleiht, denn sie wurde beendet, bevor sie sich an den Widrigkeiten des Alltags und der unterschiedlichen Lebensentwürfe zerrieb.
 Ich werde auf jeden Fall wieder nach Worpswede fahren und mich vorher mit Lektüre über die beeindruckenden Menschen der Künstlerkolonie einstimmen. Zur Zeit lese ich mein dort erworbenes Buch „Kunst und Glaube in Worpswede“, das mit wunderschönen Bildern illustriert ist. Und beim nächsten Mal werde ich es mir gönnen, in Paula Modersohn-Beckers Künstleratelier zu wohnen.
Ich werde auf jeden Fall wieder nach Worpswede fahren und mich vorher mit Lektüre über die beeindruckenden Menschen der Künstlerkolonie einstimmen. Zur Zeit lese ich mein dort erworbenes Buch „Kunst und Glaube in Worpswede“, das mit wunderschönen Bildern illustriert ist. Und beim nächsten Mal werde ich es mir gönnen, in Paula Modersohn-Beckers Künstleratelier zu wohnen.Mittwoch, 29. Mai 2013
Es geht also doch
Freund,
wer Sie auch sind - vielleicht haben Sie einfach die Zufälligkeiten des Internet auf diese Seite geführt -, wie dem auch sei, seien Sie willkommen! Sie werden hier nichts oder nur wenig von dem finden, was die gegenwärtige Welt schätzt. Wir haben uns nicht einmal bemüht, etwas Originelles zu bieten.
Dieser Internetauftritt ist ja nun etwas völlig anderes als die übliche Hochstapelei auf Websites. Und kann durchaus als Tiefstapelei durchgehen, denn die Seite ist in ihrer Klarheit und Einfachheit unter dem Verzicht auf die übliche Phrasendrescherei und geschönte Fotos sehr originell. Selbst einem Website-Feind wie mir gefällt diese Seite.
wer Sie auch sind - vielleicht haben Sie einfach die Zufälligkeiten des Internet auf diese Seite geführt -, wie dem auch sei, seien Sie willkommen! Sie werden hier nichts oder nur wenig von dem finden, was die gegenwärtige Welt schätzt. Wir haben uns nicht einmal bemüht, etwas Originelles zu bieten.
Dieser Internetauftritt ist ja nun etwas völlig anderes als die übliche Hochstapelei auf Websites. Und kann durchaus als Tiefstapelei durchgehen, denn die Seite ist in ihrer Klarheit und Einfachheit unter dem Verzicht auf die übliche Phrasendrescherei und geschönte Fotos sehr originell. Selbst einem Website-Feind wie mir gefällt diese Seite.
Donnerstag, 6. Oktober 2011
Dinge, die gut tun
Vor zwei Tagen habe ich wieder an einem Seminar teilgenommen und profitiere immer noch von der dort herrschenden Atmosphäre. Immer wieder bin ich erstaunt, wie viele Menschen es gibt, die sich sozial engagieren. Ich selbst schaffe dies neben meiner Arbeit nicht und bin überrascht, wie es manchen Menschen gelingt, so viel Zeit und Energie aufzubringen.
Erstaunt bin ich auch über den Umgang mit dem Alter. So nahm an dem Seminar auch eine 79jährige Frau teil, die sich vorgenommen hat, im kommenden Jahr nach Indien zu fahren. Ich selbst war zwar auch schon in Indien, aber „nur“ im Himalaya. Mit dem „nur“ ist keine Abwertung gemeint, sondern die Tatsache, dass die Himalayaregion – genauer gesagt Dharamsala – relativ bequem zu bereisen ist, was man von den übrigen Teilen Indiens nicht gerade sagen kann. Wenn sich jemand so eine Reise im Alter von 80 Jahren noch zutraut, dann ermutigt mich dies, mich so einer Herausforderung auch zu stellen.
Eine andere Teilnehmerin hatte ihr drei Monate altes Baby mitgebracht. Trotz der Tatsache, dass ein Kind in diesem Alter natürlich ständig Aufmerksamkeit braucht, hat die Mutter sich mit viel Interesse dem Seminar gewidmet. Auch das war eine angenehme Erfahrung.
Obwohl kaum Zeit für private Unterhaltung war, hat mich das, was ich aus dem privaten Leben der anderen erfahren habe, oftmals fasziniert. Bei manchen war es die Zielstrebigkeit, mit der Lebenspläne verfolgt wurden. Bei anderen wieder die Nachdenklichkeit, mit der die bisherige Lebensplanung in Frage gestellt wurde und mit der nach neuen Wegen gesucht wurde. Manche der Teilnehmrinnen befinden sich auch in massiven Lebenskrisen, für die nach Lösungen gesucht wurde. Was allen gemein war, war ein tiefer Respekt vor der Individualität der anderen. Ein Respekt jenseits jeglicher Dogmatik, die vorgibt, zu wissen, was richtig und was falsch ist. Eine weitere Gemeinsamkeit, die ich ausnahmslos bei jeder Teilnehmerin wahrgenommen habe, ist der Wunsch nach Entwicklung.
Ein Ort innerhalb des Seminars, der mich immer wieder gefangen nimmt, ist die Bibliothek. Ich empfinde auch bei Bekannten und Freunden die Bücherregale als etwas, das Auskunft über den Besitzer gibt. Man bekommt einen kleinen Einblick in die Vorstellungswelt des anderen. Im Falle dieser Bibliothek ist es so, dass es so viele interessante Bücher dort gibt, dass man sich kaum entscheiden kann.
Das Seminarhaus liegt direkt an einem Wald, so dass man jederzeit Spaziergänge machen kann, wozu die sonnigen Spätherbsttage auch ermuntert haben. Der einzige Wermutstropfen ist die Nähe zur Autobahn, aufgrund der es immer einen Geräuschpegel im Hintergrund gibt.
Es war nicht das erste Mal, dass ich an einem der Seminare teilgenommen habe und inzwischen fühle ich mich bei der Ankunft schon fast wie zuhause. Wahrscheinlich hat fast jeder Mensch einen Ort, an dem er sich besonders wohl fühlt. Und für jeden gibt es die ihm eigenen Kriterien, von denen dieses Wohlfühlen abhängig ist. Für mich ist ein ausschlaggebendes Kriterium das des Umgangs miteinander. Und genauso wichtig ist Authentizität. Man darf sich allerdings nicht vormachen, dass es Orte gibt, die frei von Disharmonie sind. Auch im Seminar gibt es immer wieder Kleinigkeiten, die für manchmal ein Ärgernis darstellen. Aber das, was verbindet, lässt dann meist darüber hinwegsehen.
Das Wort Ver-bundenheit gefällt mir. Zu manchen Menschen gibt es so etwas wie ein Band. Ein Band, das nicht ankettet und trotzdem eine Art Halt gibt. Und den braucht man, um in der Welt zu bestehen.
Erstaunt bin ich auch über den Umgang mit dem Alter. So nahm an dem Seminar auch eine 79jährige Frau teil, die sich vorgenommen hat, im kommenden Jahr nach Indien zu fahren. Ich selbst war zwar auch schon in Indien, aber „nur“ im Himalaya. Mit dem „nur“ ist keine Abwertung gemeint, sondern die Tatsache, dass die Himalayaregion – genauer gesagt Dharamsala – relativ bequem zu bereisen ist, was man von den übrigen Teilen Indiens nicht gerade sagen kann. Wenn sich jemand so eine Reise im Alter von 80 Jahren noch zutraut, dann ermutigt mich dies, mich so einer Herausforderung auch zu stellen.
Eine andere Teilnehmerin hatte ihr drei Monate altes Baby mitgebracht. Trotz der Tatsache, dass ein Kind in diesem Alter natürlich ständig Aufmerksamkeit braucht, hat die Mutter sich mit viel Interesse dem Seminar gewidmet. Auch das war eine angenehme Erfahrung.
Obwohl kaum Zeit für private Unterhaltung war, hat mich das, was ich aus dem privaten Leben der anderen erfahren habe, oftmals fasziniert. Bei manchen war es die Zielstrebigkeit, mit der Lebenspläne verfolgt wurden. Bei anderen wieder die Nachdenklichkeit, mit der die bisherige Lebensplanung in Frage gestellt wurde und mit der nach neuen Wegen gesucht wurde. Manche der Teilnehmrinnen befinden sich auch in massiven Lebenskrisen, für die nach Lösungen gesucht wurde. Was allen gemein war, war ein tiefer Respekt vor der Individualität der anderen. Ein Respekt jenseits jeglicher Dogmatik, die vorgibt, zu wissen, was richtig und was falsch ist. Eine weitere Gemeinsamkeit, die ich ausnahmslos bei jeder Teilnehmerin wahrgenommen habe, ist der Wunsch nach Entwicklung.
Ein Ort innerhalb des Seminars, der mich immer wieder gefangen nimmt, ist die Bibliothek. Ich empfinde auch bei Bekannten und Freunden die Bücherregale als etwas, das Auskunft über den Besitzer gibt. Man bekommt einen kleinen Einblick in die Vorstellungswelt des anderen. Im Falle dieser Bibliothek ist es so, dass es so viele interessante Bücher dort gibt, dass man sich kaum entscheiden kann.
Das Seminarhaus liegt direkt an einem Wald, so dass man jederzeit Spaziergänge machen kann, wozu die sonnigen Spätherbsttage auch ermuntert haben. Der einzige Wermutstropfen ist die Nähe zur Autobahn, aufgrund der es immer einen Geräuschpegel im Hintergrund gibt.
Es war nicht das erste Mal, dass ich an einem der Seminare teilgenommen habe und inzwischen fühle ich mich bei der Ankunft schon fast wie zuhause. Wahrscheinlich hat fast jeder Mensch einen Ort, an dem er sich besonders wohl fühlt. Und für jeden gibt es die ihm eigenen Kriterien, von denen dieses Wohlfühlen abhängig ist. Für mich ist ein ausschlaggebendes Kriterium das des Umgangs miteinander. Und genauso wichtig ist Authentizität. Man darf sich allerdings nicht vormachen, dass es Orte gibt, die frei von Disharmonie sind. Auch im Seminar gibt es immer wieder Kleinigkeiten, die für manchmal ein Ärgernis darstellen. Aber das, was verbindet, lässt dann meist darüber hinwegsehen.
Das Wort Ver-bundenheit gefällt mir. Zu manchen Menschen gibt es so etwas wie ein Band. Ein Band, das nicht ankettet und trotzdem eine Art Halt gibt. Und den braucht man, um in der Welt zu bestehen.
Sonntag, 16. Januar 2011
Vom Lob des Unterschieds – une nuit chez les amis des Berbères
Eben gerade habe ich den Film "Couscous mit Fisch" gesehen. Ein furchtbar trauriges Ende. Aber ein Tanzfinale, dass man nicht oft genug ansehen kann - und so gut zu diesem Bericht über meine Tanznacht passt, dass ich es hier nachträglich einfüge:
Es liegt schon Ewigkeiten zurück, dass ich eine Nacht mit arabischem Tanz verbracht habe. Vor vielen Jahren gab es in Hamburg ein Restaurant namens „Z“, in dem am Wochenende die Gruppe „Tausendundeine Nacht“ bis zum frühen Morgen spielte. Solange das „Z“ bestand, war ich dort auch regelmäßig zu Gast.
Aber eigentlich muss ich noch weiter vorgreifen, denn das erste Mal wurde ich mit orientalischem Tanz in Griechenland konfrontiert. Auf der kleinen ägäischen Insel Thassos gab es eine Disco, in der wie in deutschen Discos auch die damals übliche Rock- und Popmusik gespielt wurde. Dann wurde aber plötzlich das Licht gedämpft und es erklangen völlig andere Töne. Es wurde Rembetiko und Tsiftedeli gespielt. Letztere ist eine schnelle und heftige Musik, die die griechische Version der türkischen Bauchtanzmusik darstellt, die ihren Ursprung in der türkischen Besetzung Griechenlands hat.
Obwohl ich damals diese Art der Musik das erste Mal hörte, war sie mir sofort vertraut. Und ich war völlig beeindruckt, wie verspielt und erotisch Tanzen sein kann. Während in den deutschen Discos mehr oder weniger autistisch vor sich hin gewogt wird, besteht der orientalische Tanz aus einem Miteinander. Bauchtanz ist nämlich nicht nur ein Tanz, der von einer einzelnen Tänzerin vorgeführt wird, während die anderen aufs Klatschen beschränkt sind – Bauchtanz wird auch – oder eigentlich gerade – zusammen getanzt. Das kann ein Tanz unter Männern, ein Tanz unter Frauen oder auch ein gemischtgeschlechtlicher Tanz sein.
Ich war überglücklich, als ich nach einigen Jahren das „Z“ in Hamburg entdeckte. Trotz des griechischen Namens – der Name „Z“ spielt auf den gleichnamigen Roman von Vassilis Vassilikos und den Film von Contantin Costa-Gavras über die Zeit der griechischen Militärdiktatur an – wurde nicht nur griechische, sondern auch arabische Musik gespielt. Aber was auch gespielt wurde – es herrschte immer eine Stimmung, die man am besten mit dem Wort überkochend charakterisieren kann.
Aber wie bereits erwähnt, schloss das „Z“ irgendwann und ich habe eigentlich nie einen adäquaten Ersatz gefunden. Es gab immer nur vereinzelt Abende, die an mich an meine Zeit im „Z“ erinnerten. Aber gestern war wieder so ein Abend. Mein Freund betreut einen aus der Kabylei (Algerien) stammenden Mann und dessen 4-jährige Tochter. Und der lud uns zu dem kabylischen Neujahrsfest „Jannayer“ ein. Wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich gestern das Jahr 2961 gefeiert.
Und nach vielen Jahren erfuhr ich wieder, wie es sich anfühlt, wenn etwas überkocht. Wenn so heftig getanzt wird, dass nach kurzer Zeit der Schweiß läuft. Wenn Menschen mitten im Tanz oder beim Zuhören der Musik plötzlich frenetisch klatschen, weil der Sänger etwas gesungen hat, was heftige Zustimmung auslöst. Oder aber wenn die Frauen statt des Klatschens als Zustimmung, einen lauten und schrillen Singsang ertönen lassen, dem wiederum oftmals von anderen ebenso lauthals applaudiert wird. Und man kann etwas beobachten, was es in unseren Breitengraden nicht oder zumindest nur sehr selten gibt – das sinnliche Umwerben der Geschlechter. Von männlicher Seite hartnäckig, von weiblicher spöttisch und halbherzig zurückweisend. Für viele ein antiquiertes und überflüssiges Relikt aus vergangenen Zeiten, hat es dennoch den Reiz von etwas Zauberhaften und Geheimnisvollen.
Trotz später Stunde feiern auch noch jede Menge kleine quirlige Kinder mit, die zwar alles andere als leise sind, aber die nicht am Schürzenzipfel ihrer Eltern hängen, sondern sofort Freundschaft mit anderen Kindern schließen und somit die Eltern in Ruhe feiern lassen.
Auf diesen Feiern ist es fast immer unmöglich, mit einem „Nein“ auf angebotene Speisen und Getränke zu reagieren. Es scheint immer die Sorge zu bestehen, dass man nicht satt wurde oder Durst leidet, auch wenn man das Gegenteil versichert. Und so wird man liebevoll mit Cous Cous, Dattelkuchen, Wein und zuckersüßem Pfefferminztee versorgt. Alles ist im Überfluss vorhanden, auch wenn zeitweiliggerade die Teller oder die Bestecke ausgegangen sind. Denn auch das gehört oftmals zu einem orientalischen Fest – eine gute Portion Chaos. Irgendwo gibt es immer einen Engpass und irgendwo bricht etwas zusammen. Dann wird lauthals und heftig nach einer Lösung gesucht – die auch immer irgendwie gefunden wird.
Wenn man die Unterschiede in der menschlichen Mentalität kennenlernen möchte, sollte man mit anderen Menschen feiern. Nichts ist aufschlussreicher als dies. Auch wenn das Feiern nur einen winzigen Teil des alltäglichen Lebens darstellt – es eröffnet dennoch einen Einblick in eine andere Welt. Die Art, wie Menschen Glück und Lebenslust ausdrücken, spiegelt auch immer ihre ganz spezifische und unverkennbare Art des Umgangs miteinander wieder.
Und deswegen lobe ich den Unterschied. Und genieße ihn. Und atme erleichtert auf, weil es nicht stimmt, dass alle Menschen gleich sind.
Es liegt schon Ewigkeiten zurück, dass ich eine Nacht mit arabischem Tanz verbracht habe. Vor vielen Jahren gab es in Hamburg ein Restaurant namens „Z“, in dem am Wochenende die Gruppe „Tausendundeine Nacht“ bis zum frühen Morgen spielte. Solange das „Z“ bestand, war ich dort auch regelmäßig zu Gast.
Aber eigentlich muss ich noch weiter vorgreifen, denn das erste Mal wurde ich mit orientalischem Tanz in Griechenland konfrontiert. Auf der kleinen ägäischen Insel Thassos gab es eine Disco, in der wie in deutschen Discos auch die damals übliche Rock- und Popmusik gespielt wurde. Dann wurde aber plötzlich das Licht gedämpft und es erklangen völlig andere Töne. Es wurde Rembetiko und Tsiftedeli gespielt. Letztere ist eine schnelle und heftige Musik, die die griechische Version der türkischen Bauchtanzmusik darstellt, die ihren Ursprung in der türkischen Besetzung Griechenlands hat.
Obwohl ich damals diese Art der Musik das erste Mal hörte, war sie mir sofort vertraut. Und ich war völlig beeindruckt, wie verspielt und erotisch Tanzen sein kann. Während in den deutschen Discos mehr oder weniger autistisch vor sich hin gewogt wird, besteht der orientalische Tanz aus einem Miteinander. Bauchtanz ist nämlich nicht nur ein Tanz, der von einer einzelnen Tänzerin vorgeführt wird, während die anderen aufs Klatschen beschränkt sind – Bauchtanz wird auch – oder eigentlich gerade – zusammen getanzt. Das kann ein Tanz unter Männern, ein Tanz unter Frauen oder auch ein gemischtgeschlechtlicher Tanz sein.
Ich war überglücklich, als ich nach einigen Jahren das „Z“ in Hamburg entdeckte. Trotz des griechischen Namens – der Name „Z“ spielt auf den gleichnamigen Roman von Vassilis Vassilikos und den Film von Contantin Costa-Gavras über die Zeit der griechischen Militärdiktatur an – wurde nicht nur griechische, sondern auch arabische Musik gespielt. Aber was auch gespielt wurde – es herrschte immer eine Stimmung, die man am besten mit dem Wort überkochend charakterisieren kann.
Aber wie bereits erwähnt, schloss das „Z“ irgendwann und ich habe eigentlich nie einen adäquaten Ersatz gefunden. Es gab immer nur vereinzelt Abende, die an mich an meine Zeit im „Z“ erinnerten. Aber gestern war wieder so ein Abend. Mein Freund betreut einen aus der Kabylei (Algerien) stammenden Mann und dessen 4-jährige Tochter. Und der lud uns zu dem kabylischen Neujahrsfest „Jannayer“ ein. Wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich gestern das Jahr 2961 gefeiert.
Und nach vielen Jahren erfuhr ich wieder, wie es sich anfühlt, wenn etwas überkocht. Wenn so heftig getanzt wird, dass nach kurzer Zeit der Schweiß läuft. Wenn Menschen mitten im Tanz oder beim Zuhören der Musik plötzlich frenetisch klatschen, weil der Sänger etwas gesungen hat, was heftige Zustimmung auslöst. Oder aber wenn die Frauen statt des Klatschens als Zustimmung, einen lauten und schrillen Singsang ertönen lassen, dem wiederum oftmals von anderen ebenso lauthals applaudiert wird. Und man kann etwas beobachten, was es in unseren Breitengraden nicht oder zumindest nur sehr selten gibt – das sinnliche Umwerben der Geschlechter. Von männlicher Seite hartnäckig, von weiblicher spöttisch und halbherzig zurückweisend. Für viele ein antiquiertes und überflüssiges Relikt aus vergangenen Zeiten, hat es dennoch den Reiz von etwas Zauberhaften und Geheimnisvollen.
Trotz später Stunde feiern auch noch jede Menge kleine quirlige Kinder mit, die zwar alles andere als leise sind, aber die nicht am Schürzenzipfel ihrer Eltern hängen, sondern sofort Freundschaft mit anderen Kindern schließen und somit die Eltern in Ruhe feiern lassen.
Auf diesen Feiern ist es fast immer unmöglich, mit einem „Nein“ auf angebotene Speisen und Getränke zu reagieren. Es scheint immer die Sorge zu bestehen, dass man nicht satt wurde oder Durst leidet, auch wenn man das Gegenteil versichert. Und so wird man liebevoll mit Cous Cous, Dattelkuchen, Wein und zuckersüßem Pfefferminztee versorgt. Alles ist im Überfluss vorhanden, auch wenn zeitweiliggerade die Teller oder die Bestecke ausgegangen sind. Denn auch das gehört oftmals zu einem orientalischen Fest – eine gute Portion Chaos. Irgendwo gibt es immer einen Engpass und irgendwo bricht etwas zusammen. Dann wird lauthals und heftig nach einer Lösung gesucht – die auch immer irgendwie gefunden wird.
Wenn man die Unterschiede in der menschlichen Mentalität kennenlernen möchte, sollte man mit anderen Menschen feiern. Nichts ist aufschlussreicher als dies. Auch wenn das Feiern nur einen winzigen Teil des alltäglichen Lebens darstellt – es eröffnet dennoch einen Einblick in eine andere Welt. Die Art, wie Menschen Glück und Lebenslust ausdrücken, spiegelt auch immer ihre ganz spezifische und unverkennbare Art des Umgangs miteinander wieder.
Und deswegen lobe ich den Unterschied. Und genieße ihn. Und atme erleichtert auf, weil es nicht stimmt, dass alle Menschen gleich sind.
Donnerstag, 28. Januar 2010
Einbauküche oder Kerosinkocher?
Und wieder ein neues Buch: "Mein Leben in Bhutan" von Jamie Zeppa. Die kanadische Autorin hat vor vielen Jahren einen Stelle als Englischlehrerin in Bhutan angenommen. Seit einigen Jahren lebt sie wieder in Kanada und hat jetzt über ihre Jahre in Bhutan ein Buch geschrieben.
Ich habe eine enorme Bewunderung für Frauen, die sich in solche Abenteuer wagen. Und empfinde es ungemein fesselnd, über die Bewältigung eines Alltags zu lesen, der sich in absolut allem von dem unseren unterscheidet. In einem Zimmer ohne fließend Wasser, ohne Strom, ohne Kühlschrank und Herd leben. Seine Mahlzeiten auf einem Kerosinkocher zubereiten, der jederzeit zu explodieren droht. Ein Zimmer, in dem nachts die Ratten auf dem Küchenboden spielen und auch ansonsten allerhand Getier beherbergt. Zu lesen, daß all dies letztendlich keine besondere Einschränkung bedeutet. Von einer Natur zu lesen, die so atemberaubend ist, daß alles andere völlig belanglos wird.
Anfänglich ist die Autorin sehr verzweifelt und hat Angst, alles durchzustehen. Doch dann verliebt sie sich in diese einzigartige Land. Später auch in einen seiner Bewohner, mit dem sie ein Kind hat.
Es gibt noch mehr so ungewöhnliche Frauen wie Jamie Zeppa. Die Irin Dervla Murphy fuhr beispielsweise schon in den 60ern von Irland mit dem Fahrrad (Mountanbikes gab es da noch nicht!) nach Indien. Die Französin Alexandra David-Néel bereiste - zeitweilig als Mann verkleidet - in den 30er Jahren Tibet, Nepal und Indien. Mutige Frauen, die die Weite der kleinbürgerlichen Enge vorzogen. Und denen wir wunderschöne Reiseberichte verdanken.
Nicht jedem gefallen diese Reisegeschichten. Bürokolleginnen schütteln ihre Köpfe mit dem stereotypen Kommentar: "Zuhause habe ich es doch viel besser". Andere wiederum reden von völlig überflüssiger und unsinniger Selbstkasteiung.
Aber mich fasziniert nichts mehr als Menschen, die den Mut haben, solche Träume wahr zu machen. Ich selbst träume nur davon, denn ich traue mir die damit verbundenen körperlichen Strapazen nicht zu. Mit dem Fehlen von Luxus könnte ich es wahrscheinlich aufnehmen aber nicht mit den Anforderungen tagelanger Fußmärsche bei glühender Hitze oder klirrender Kälte und dem Fehlen jeglicher medizinischer Versorgung.
Ja, ich bewundere sie - diese Frauen, die einen kleinen Kerosinkocher einer Einbauküche, einem Induktionskochfeld und einem Umluftbackofen vorziehen. Soche Frauen zu treffen wäre schon Grund genug, Bhutan zu bereisen...
Ich habe eine enorme Bewunderung für Frauen, die sich in solche Abenteuer wagen. Und empfinde es ungemein fesselnd, über die Bewältigung eines Alltags zu lesen, der sich in absolut allem von dem unseren unterscheidet. In einem Zimmer ohne fließend Wasser, ohne Strom, ohne Kühlschrank und Herd leben. Seine Mahlzeiten auf einem Kerosinkocher zubereiten, der jederzeit zu explodieren droht. Ein Zimmer, in dem nachts die Ratten auf dem Küchenboden spielen und auch ansonsten allerhand Getier beherbergt. Zu lesen, daß all dies letztendlich keine besondere Einschränkung bedeutet. Von einer Natur zu lesen, die so atemberaubend ist, daß alles andere völlig belanglos wird.
Anfänglich ist die Autorin sehr verzweifelt und hat Angst, alles durchzustehen. Doch dann verliebt sie sich in diese einzigartige Land. Später auch in einen seiner Bewohner, mit dem sie ein Kind hat.
Es gibt noch mehr so ungewöhnliche Frauen wie Jamie Zeppa. Die Irin Dervla Murphy fuhr beispielsweise schon in den 60ern von Irland mit dem Fahrrad (Mountanbikes gab es da noch nicht!) nach Indien. Die Französin Alexandra David-Néel bereiste - zeitweilig als Mann verkleidet - in den 30er Jahren Tibet, Nepal und Indien. Mutige Frauen, die die Weite der kleinbürgerlichen Enge vorzogen. Und denen wir wunderschöne Reiseberichte verdanken.
Nicht jedem gefallen diese Reisegeschichten. Bürokolleginnen schütteln ihre Köpfe mit dem stereotypen Kommentar: "Zuhause habe ich es doch viel besser". Andere wiederum reden von völlig überflüssiger und unsinniger Selbstkasteiung.
Aber mich fasziniert nichts mehr als Menschen, die den Mut haben, solche Träume wahr zu machen. Ich selbst träume nur davon, denn ich traue mir die damit verbundenen körperlichen Strapazen nicht zu. Mit dem Fehlen von Luxus könnte ich es wahrscheinlich aufnehmen aber nicht mit den Anforderungen tagelanger Fußmärsche bei glühender Hitze oder klirrender Kälte und dem Fehlen jeglicher medizinischer Versorgung.
Ja, ich bewundere sie - diese Frauen, die einen kleinen Kerosinkocher einer Einbauküche, einem Induktionskochfeld und einem Umluftbackofen vorziehen. Soche Frauen zu treffen wäre schon Grund genug, Bhutan zu bereisen...
Suche
Letzte Änderungen
- Agnostizismus ist auf jeden Fall nicht so... (behrens, 25.Mär.25)
- Keine Wahl... (behrens, 25.Feb.25)
- Vielleicht sollte man den Agnostizismus noch... (c. fabry, 22.Feb.25)
- Religiöse Toleranz – wenn Nathan... (behrens, 19.Jan.25)
- Die zwei Israel-Reisen 2019 und 2015! (lilith2, 06.Jan.25)
Links
Navigation
Statistik
- Online seit 6108 Tagen
- Letzte Aktualisierung:
2025.03.25, 18:15 - Du bist nicht angemeldet ... anmelden
Archiv
RSS